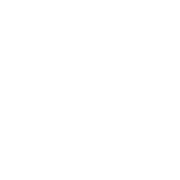Hoffman Institut Österreich
Info-Workshop zum Hoffman Prozess
Ich will Mein Leben leben!
22.09.2017 in Wien
Ich will Mein Leben leben!
22.09.2017 in Wien
- Verhältst du dich manchmal wie ferngesteuert?
- Benutzt du in bestimmten Situationen, z.B. wenn du gestresst bist, Worte, die von deinen Eltern stammen könnten?
- Entdeckst du ab und zu Ähnlichkeiten zwischen dem Verhalten deines Partners und dem deiner Eltern?
- Bist du in Vielem das Gegenteil deiner Eltern oder willst es um jeden Preis sein?
- Könntest du mehr aus deinem Leben machen?
Dann ist dieser Abend für dich!
- Benutzt du in bestimmten Situationen, z.B. wenn du gestresst bist, Worte, die von deinen Eltern stammen könnten?
- Entdeckst du ab und zu Ähnlichkeiten zwischen dem Verhalten deines Partners und dem deiner Eltern?
- Bist du in Vielem das Gegenteil deiner Eltern oder willst es um jeden Preis sein?
- Könntest du mehr aus deinem Leben machen?
Dann ist dieser Abend für dich!
Info-Workshop zum Hoffman Prozess
Ich will Mein Leben leben
Ich will Mein Leben leben
22. September 2017 um 19 Uhr
in Wien
in Wien
Worum geht es
an diesem Abend?
an diesem Abend?
An diesem Abend
- geht es um dich
- du wirst einige Zusammenhänge zwischen deinem Verhalten, deinen Denk- und Fühlmustern und deiner Geschichte entdecken
- In Theorie und Praxis wirst du Erfahrungen machen: Du bist viel mehr, als du es für möglich hältst
- Du erfährst, was der Hoffman Prozess ist, lernst einen Hoffman Trainer und die Hoffman Methode kennen, um danach aus der persönlichen Erfahrung sagen zu können, ob der Hoffman Prozess dich auf deinem Weg weiter bringen könnte.
Gespannt? Es wird spannend, herzlich Willkommen!
- geht es um dich
- du wirst einige Zusammenhänge zwischen deinem Verhalten, deinen Denk- und Fühlmustern und deiner Geschichte entdecken
- In Theorie und Praxis wirst du Erfahrungen machen: Du bist viel mehr, als du es für möglich hältst
- Du erfährst, was der Hoffman Prozess ist, lernst einen Hoffman Trainer und die Hoffman Methode kennen, um danach aus der persönlichen Erfahrung sagen zu können, ob der Hoffman Prozess dich auf deinem Weg weiter bringen könnte.
Gespannt? Es wird spannend, herzlich Willkommen!
Was ist Hoffman Prozess?
Der Hoffman Prozess ist ein einwöchiges Retreat, ein Transformations-und Bewusstseinstraining für Menschen, die etwas in ihrem Leben verändern wollen.
Während des Hoffman Prozesses erforschst du deine Herkunft - wie bist du so geworden, wie du bist? Welche Elternbilder prägen dein Leben und deine Gegenwart? Warum reagierst du so, fühlst dich so... klein, unwichtig oder mächtig, schämst dich für dich oder wirst arrogant genannt usw., warum handelst du so... ziehst dich in kritischen Situationen zurück oder greifst an, erstarrst oder wertest ab... ?
Im Hoffman Prozess geht es darum, dich mit dir auseinander zu setzen, dich anzunehmen, dir zu verzeihen und dich lieben zu lernen, um deine Lebensfreude wieder zu finden, dich einlassen zu können, deine Potentiale zu leben.
Tausende Menschen, die den Hoffman Prozess bereits gemacht haben, sagen, dass er das bedeutendste Ereignis, ein wichtiger Wendepunkt in ihrem Leben war.
Ist das innerhalb einer Woche möglich?
Ja, und auch mehrere wissenschaftliche Studien belegen die Wirksamkeit des Hoffman Prozesses.
Während des Hoffman Prozesses erforschst du deine Herkunft - wie bist du so geworden, wie du bist? Welche Elternbilder prägen dein Leben und deine Gegenwart? Warum reagierst du so, fühlst dich so... klein, unwichtig oder mächtig, schämst dich für dich oder wirst arrogant genannt usw., warum handelst du so... ziehst dich in kritischen Situationen zurück oder greifst an, erstarrst oder wertest ab... ?
Im Hoffman Prozess geht es darum, dich mit dir auseinander zu setzen, dich anzunehmen, dir zu verzeihen und dich lieben zu lernen, um deine Lebensfreude wieder zu finden, dich einlassen zu können, deine Potentiale zu leben.
Tausende Menschen, die den Hoffman Prozess bereits gemacht haben, sagen, dass er das bedeutendste Ereignis, ein wichtiger Wendepunkt in ihrem Leben war.
Ist das innerhalb einer Woche möglich?
Ja, und auch mehrere wissenschaftliche Studien belegen die Wirksamkeit des Hoffman Prozesses.
In meiner Kindheit liebte ich es, Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Wir bauten ein Haus, ich hielt ihm die Nägel, hob den Hammer, saß auf den Brettern als Gewicht, wenn er sägte. Ich war zwar ein Mädchen aber gleichzeitig sein bester "Sohn", denn er hatte sich immer einen Jungen gewünscht. Er war Atomphysiker aus Leidenschaft, wanderte in den Bergen mit anderen „richtigen" Männern und sang am Lagerfeuer Lieder. Einer seiner Lieblingssätze war „Alles ist nicht so einfach"... und er machte sich über meine „Mädchen-Ausbrüche", wie z.B. Verkleiden oder sonstigen Quatsch, lustig. Er war ein Toller, er war mein Held.
Später trug ich gerne Hosen. Ich schämte mich unerklärlich für meine eigentlich ganz passable Figur, war mit Jungs lieber befreundet, Mädchen und Frauen fand ich meist zickig und oberflächlich. Später stritt ich viel mit meinem Vater. Ich musste mich lösen und das gelang mir ganz gut, dachte ich, indem ich alles anders machte, als er es sich für mich vorgestellt hatte. Aber die Männer in meinem Leben wurden trotzdem daran gemessen, ob sie Sartre verstanden und mir den Motor eines TU 154 erklären konnten. Ich wusste nicht genau, wie man eine richtige Frau ist, dafür aber, was ein richtiger Mann alles können und wissen sollte. Was würde wohl mein Vater dazu sagen?
Das Vaterbild lebte lange weiter in mir, prägte meine Beziehungen, mein Leben. Wie wirken die Elternbilder? Na so: unter der Haut, als Hintergrund, durchgehend. Bis man sich dessen bewusst wird und anfängt, die unsichtbare Nabelschnur zu trennen.
Später trug ich gerne Hosen. Ich schämte mich unerklärlich für meine eigentlich ganz passable Figur, war mit Jungs lieber befreundet, Mädchen und Frauen fand ich meist zickig und oberflächlich. Später stritt ich viel mit meinem Vater. Ich musste mich lösen und das gelang mir ganz gut, dachte ich, indem ich alles anders machte, als er es sich für mich vorgestellt hatte. Aber die Männer in meinem Leben wurden trotzdem daran gemessen, ob sie Sartre verstanden und mir den Motor eines TU 154 erklären konnten. Ich wusste nicht genau, wie man eine richtige Frau ist, dafür aber, was ein richtiger Mann alles können und wissen sollte. Was würde wohl mein Vater dazu sagen?
Das Vaterbild lebte lange weiter in mir, prägte meine Beziehungen, mein Leben. Wie wirken die Elternbilder? Na so: unter der Haut, als Hintergrund, durchgehend. Bis man sich dessen bewusst wird und anfängt, die unsichtbare Nabelschnur zu trennen.
Wer leitet den Workshop?
Holger Dick ist Hoffman Trainer seit über 20 Jahren, Direktor, Supervisor und Ausbilder der Hoffman Institute Österreich und Russland, Theater- und Dramatherapeut (DGfT) und familylab-Seminarleiter. Nach Ausbildungen in verschiedenen Methoden der humanistischen Psychologie, wie Rebirthing, Körperarbeit (Meditation in Action) und Encounter, arbeitete Holger viele Jahre als Gruppenleiter in Selbsterfahrungsprozessen.
Neben seiner Hoffman-Tätigkeit in Deutschland, England, Russland und Österreich entwickelte er und leitet bis heute Eltern-Kurse für das Zentrum für Familie Markin Dick.
Holger Dick ist Vater dreier Kinder und eines Stiefsohnes und Großvater dreier Enkel.
Neben seiner Hoffman-Tätigkeit in Deutschland, England, Russland und Österreich entwickelte er und leitet bis heute Eltern-Kurse für das Zentrum für Familie Markin Dick.
Holger Dick ist Vater dreier Kinder und eines Stiefsohnes und Großvater dreier Enkel.
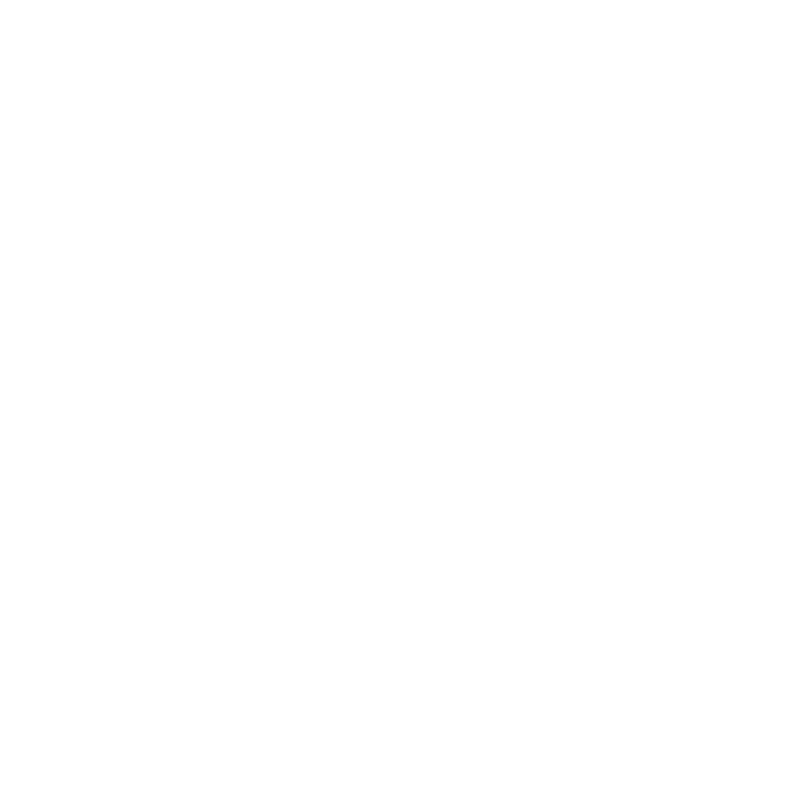
Holger Dick
Was erwartet dich?
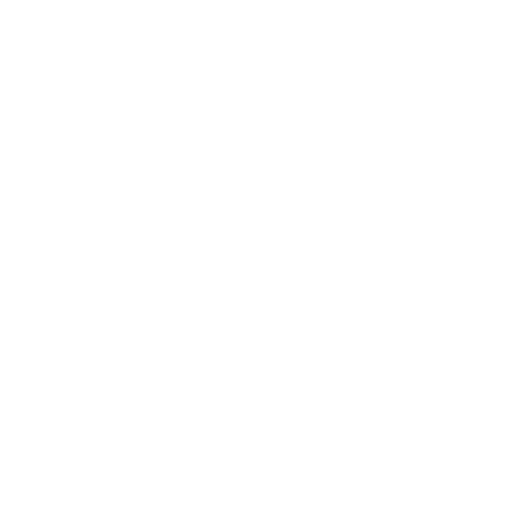
Theorie
Was sind Muster, wie sie entstehen und wirken. Was ist der Hoffman Prozess und wie er funktioniert.
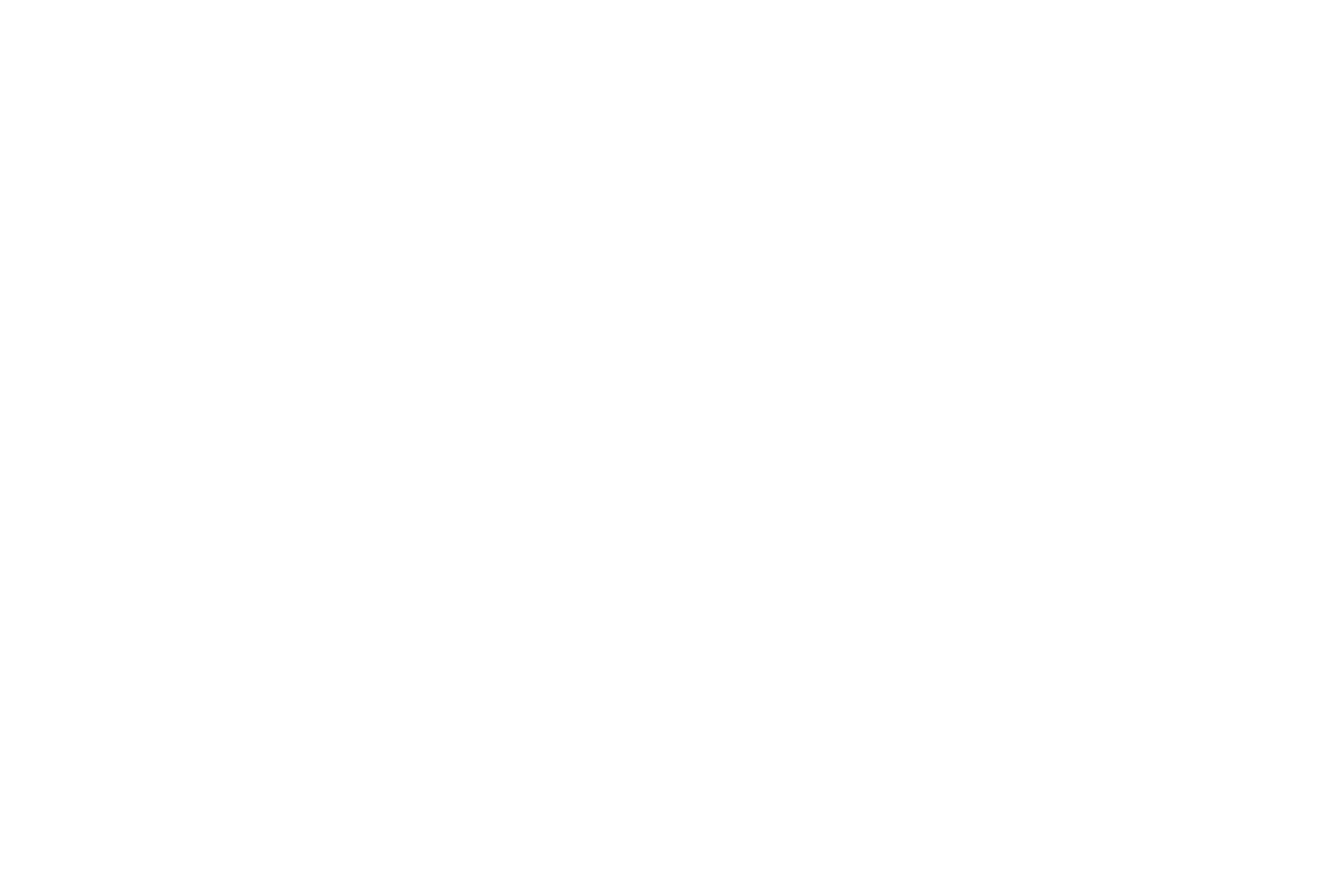
Übungen
Welche Muster hast du von deinen Eltern übernommen und mit welchen Auswirkungen? Bist du ein Rebell? Warum handelst du manchmal so automatisch und geht es auch anders?
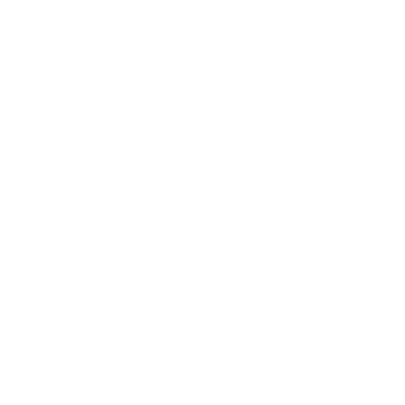
Kennenlernen
Du lernst einen Hoffman Trainer kennen, sowie einige der Grundlagen des Hoffman Prozesses, um testen zu können, ob der Hoffman Prozess für dich nützlich sein könnte.
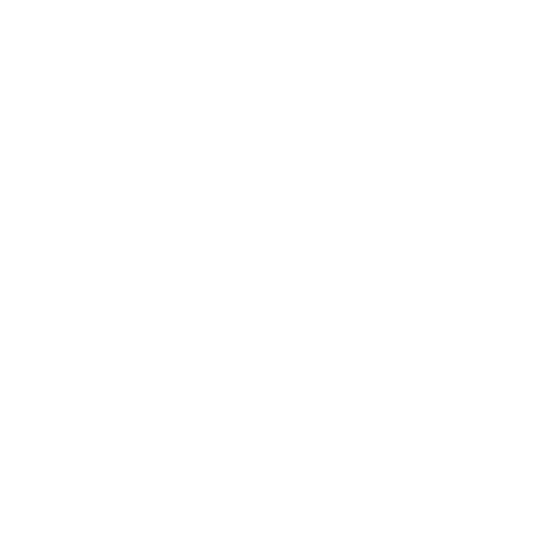
Geschenk
Eine Ahnung, ein Geschmack davon, wer du wirklich bist.
Es ist leichter, die Füße mit Schuhen zu schützen,
als die ganze Welt mit Teppichen zu beziehen.
als die ganze Welt mit Teppichen zu beziehen.

Wann?
22.09.2017
19 - 22 Uhr
19 - 22 Uhr
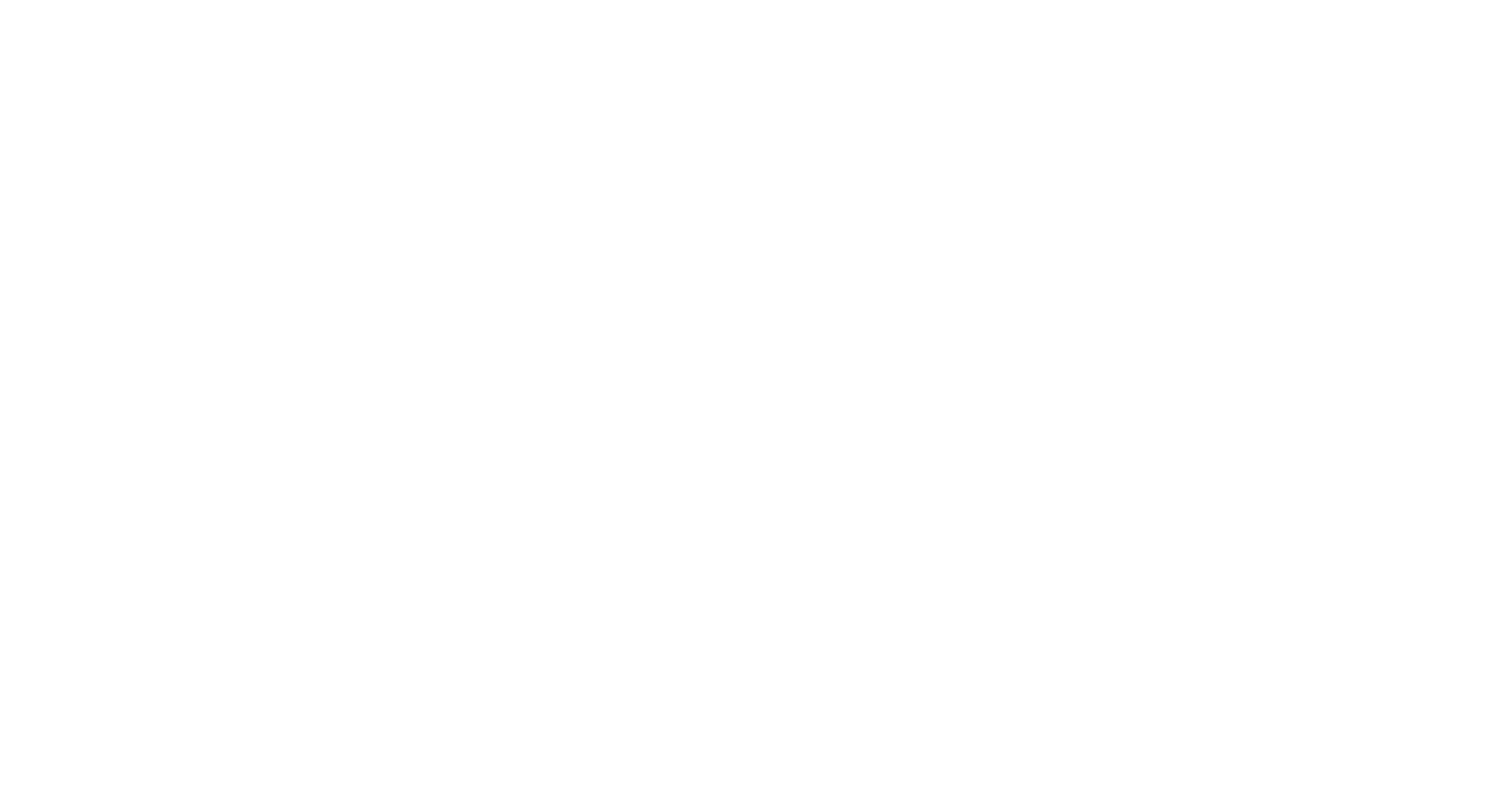
Anmeldung zum Info-Workshop
"Ich will mein Leben leben!"
"Ich will mein Leben leben!"
Danke für Ihre Anmeldung
Möchten sie unseren Newsletter abonnieren?
Newsletter
Wir informieren sie regelmäßig über Veranstaltungen und Neuigkeiten im Hoffman Institut und teilen mit Ihnen inspirierende Momente, Denkstücke für das Wachsein im Alltag.
Danke für Ihr Interesse
Möchten sie sich zu einem unverbindlichen und kostenlosen Telefongespräch anmelden?
Telefongespräch
Hoffman Institut Österreich
- Paris Lodron Str. 16
A-5020 Salzburg
- Paris Lodron Str. 16
- Mail: info@hoffman-institut.at
INFORMATIONEN
IMPRESSUM
- Geschäftsführerin: Daria Markin
Inhaltlich verantwortlich gemäß § 55.Abs.2 RStV: Daria Markin - AGB
- Geschäftsführerin: Daria Markin